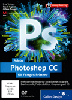5 Schwarzweiß, Duplex und Schmuckfarben
Das Thema Farbe taucht bei der Arbeit mit Photoshop an verschiedenen Stellen auf. Statt es in einem Block theoretisch abzuhandeln, um dann bei den einzelnen Anwendungen darauf zu verweisen, soll in diesem Buch alles Wichtige zu diesem Thema anwendungsspezifisch besprochen werden.
Farbe spielt in drei großen Bereichen eine wichtige Rolle:
- Farbkorrektur (Kapitel 6)
- Farbmanagement (Kapitel 7)
- Druckausgabe (Kapitel 12)
Auf die wichtigsten Grundlagen soll aber bereits an dieser Stelle eingegangen werden.
5.1 Grundlagen: RGB, CMYK und Lab 

5.1.1 RGB 

Technisch gesehen arbeiten Bildschirme, Scanner und Digitalkameras mit den drei Grundfarben des additiven Farbsystems. Beim Auge gibt es bei den Farbrezeptoren (Zäpfchen) drei Typen jeweils für Rot, Grün und Blau, wenn auch in ungleicher Empfindlichkeit: Das Auge nimmt grün dominant wahr. Im technischen Bereich sind die drei Grundfarben gleichberechtigt.
[Additives Farbsystem] Die Farbmischung erfolgt durch Addition von Lichtfarben. Die Summe aller drei Farben ergibt Weiß.
Die Gesamtheit der vom Auge unterscheidbaren Farbnuancen lässt sich mit 256 Farben pro Grundfarbe ausreichend darstellen. Da 256, also 28 , einem Byte der »Computersprache« entspricht und sich alle wahrnehmbaren Farben mit 3 Byte darstellen lassen, ist diese digitale Verarbeitung von Farbe der Standard. So kann man verallgemeinernd sagen, dass praktisch alles, was im Computer und um ihn herum Bilddaten verarbeitet, deshalb auf der Basis von RGB funktioniert.
Abbildung 5.1 Additive Farbmischung bei RGB
5.1.2 CMYK 

Anders als bei RGB, das auf der additiven Mischung von Lichtfarben basiert, wird bei CMYK auftreffendes Licht durch Deckung der hellen (Papier-)Oberfläche weggenommen. Dabei »filtern« die drei Buntfarben Cyan, Magenta und Gelb die entsprechenden Anteile des Lichts beim Auftreffen auf die Oberfläche heraus. Weil alle drei zusammen das nur in der Theorie komplett können, braucht man in der Praxis zusätzlich Schwarz (Key), um eine vollständige Deckung zu erreichen.
Abbildung 5.2 Subtraktive Farbmischung bei CMY
Subtraktive Farbmischung | Man bezeichnet das Ganze deshalb auch als subtraktive Farbmischung, was übrigens dazu führt, dass eine ganze Reihe von Reglern in den Einstelldialogen im Gegensatz zu RGB genau umgekehrt funktioniert: Bei RGB wird eine Farbe von 0 bis 255 heller, bei CMYK steigt der Auftrag einer Farbe von 0 bis 100 %, sie wird also dunkler.
Wenn bei einem Bild von vornherein klar ist, dass es später gedruckt werden soll, liegt es eigentlich nahe, gleich mit den Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zu arbeiten. Da aber der Umfang der darstellbaren Farben bei CMYK wesentlich kleiner ist als bei RGB, sind die Bearbeitungsmöglichkeiten auch teilweise sehr beschränkt.
Manches, vor allem einige Filter, funktioniert in Photoshop im CMYK-Modus überhaupt nicht. Trotz dieser Einschränkungen ist die Bearbeitung eines Bildes im CMYK-Modus durchaus sinnvoll, z. B. wenn Scans schon in CMYK angeliefert werden. Da wir hier bereits im Zielfarbraum für den Druck sind, ist es oft nicht sinnvoll, ein solches Bild für die Bearbeitung z. B. nach RGB und danach wieder retour zu konvertieren.
5.1.3 Lab 

Von den drei grundlegenden Farbmodellen RGB, CMYK und Lab entspricht letzteres dem menschlichen Sehen, weil die Luminanz-Komponente strikt von den Farbkomponenten und getrennt behandelt wird, wie es auch das Auge mit den Stäbchen (Luminanz, Helligkeit) und den Zäpfchen (Chrominanz, Farbe) tut.
Lab lässt sich vereinfacht auch als Zylinder darstellen. Die Achse des Zylinders repräsentiert die Luminanz und sein Radius die Sättigung. Um den Umfang des Zylinders herum finden wir die Farbtöne.
Abbildung 5.3 Vereinfachte Darstellung von Lab als Zylinder
Durch die Trennung von Helligkeits- und Farbinformation beim Lab-Modus kann man die Farbigkeit eines Bildes bearbeiten, ohne Kontrast und Helligkeit zu beeinflussen und umgekehrt den Kontrast ohne Farbverschiebungen korrigieren. Man kann deshalb auch aus einem Bild im Lab-Modus schnell ein korrektes Schwarzweißbild machen, indem man lediglich die beiden Farbkomponenten a und b entfernt.
Abbildung 5.4 Sehr schmaler Bearbeitungs-bereich im Farbkanal a
Nachteil | Ein Nachteil von Lab sei nicht verschwiegen: Manche Operationen in den Farbkomponenten a und b sind relativ schwer einzustellen, vor allem bei der Tonwertkorrektur (Abbildung 5.4) und den Gradationskurven. Keinen Unterschied gibt es bei Farbton/Sättigung, weil hier ja auch die Helligkeit von der Farbe (Tonwinkel und Sättigung) getrennt behandelt wird.
Ihre Meinung
Wie hat Ihnen das Openbook gefallen? Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback als E-Mail an kommunikation@rheinwerk-verlag.de.


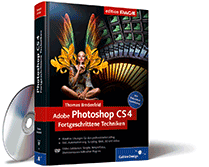
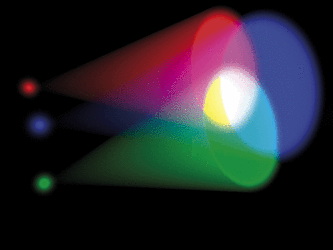
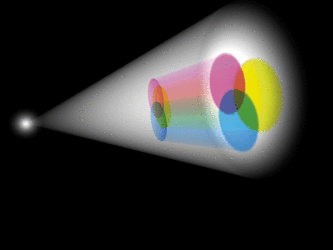
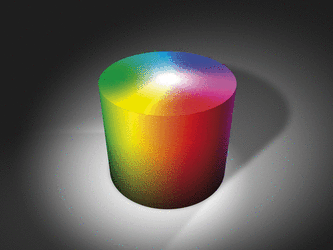
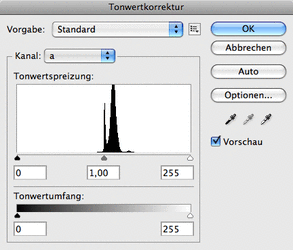
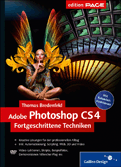
 bestellen
bestellen