2.6 HDR-Bilder richtig belichten 

Häufig herrscht die Meinung vor, im Rahmen der HDR-Fotografie habe die korrekte Belichtung einen nicht so hohen Stellenwert wie in der klassischen Fotografie. Man könnte es sich also einfach machen und darauf verweisen, dass sowieso mehrere belichtete Aufnahmen zu einem Bild verrechnet werden und sich somit die richtige Belichtung zwangsläufig ergibt: etwas Tone Mapping, anschließend ins Bildbearbeitungsprogramm zur Feinarbeit, und fertig! Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Gerade in der HDR-Fotografie ist es unverzichtbar, die Belichtung im Griff zu haben, und das setzt natürlich entsprechende Kenntnisse voraus. Korrekt aufgenommene Belichtungsreihen sind die Basis für die Erstellung guter HDR-Bilder.
Eine korrekte Belichtung ist immer abhängig von der Helligkeit des Motivs, der einfallenden Lichtmenge und der Empfindlichkeit des Aufnahmemediums (ISO). Daraus ergibt sich das passende Verhältnis zwischen Blendenöffnung und Belichtungszeit. Als HDR-Fotograf überlassen Sie das Einstellen dieser Werte aber nicht der Automatik. Sie erledigen das vielmehr manuell. Sie können die Kamera aber als Belichtungsmesser verwenden, indem Sie die optimale Motiv-Belichtung automatisch ermitteln lassen und die gemessenen Parameter als Ausgangswerte verwenden. Oder Sie setzen ein Belichtungsmessgerät ein.
Abbildung 2.36 Belichtungszeit 2 sek: Das Bild ist stark überbelichtet.
Abbildung 2.37 Belichtungszeit 0,5 sek: überbelichtet
Abbildung 2.38 Belichtungszeit 1/8 sek: Dies wäre die korrekt belichtete Aufnahme. Sämtliche Aufnahmen sind mit einer Blendeneinstellung von 5,6, einer Lichtempfindlichkeit von ISO 100 und einem Weißabgleich von 5 800 Kelvin erstellt worden. Die Bilder haben einen Unterschied von zwei Blendenstufen (EV).
Abbildung 2.39 Belichtungszeit 1/30 sek: unterbelichtet
Abbildung 2.40 Belichtungszeit 1/125 sek: Das Bild ist stark unterbelichtet.
| HINWEIS |
|
Unterbelichtete Bilder bieten im Rahmen der Korrektur wesentlich mehr Spielraum als überbelichtete Aufnahmen. Die Korrektur einer Unterbelichtung von einer Blendenstufe ist mit weniger Verlust behaftet, als wenn das Bild um eine Blendenstufe überbelichtet ist. Aus einer überbelichteten Aufnahme mit ausgefressenen Lichtern lässt sich kaum noch Zeichnung herausholen. Unterbelichtete Bereiche haben dagegen häufig noch Zeichnung, die mit etwas Fingerspitzengefühl und den entsprechenden Werkzeugen herausgearbeitet werden können. |
2.6.1 Eine Belichtungsreihe erstellen 

Ein echtes HDR-Bild besteht immer aus mehreren unterschiedlich belichteten Aufnahmen. Ob das nun drei, fünf, sieben, neun oder mehr Aufnahmen sind, hängt vom Motiv und der Aufnahmesituation ab. Grundsätzlich gilt: Je kontrastreicher die Szenerie, desto mehr Aufnahmen sind notwendig, um den größtmöglichen Kontrastumfang abzubilden.
| Mindestens drei |
|
In der Praxis kann ein HDR-Bild schon aus zwei Aufnahmen generiert werden, aus einer über- und einer unterbelichteten Fotografie. Es ist jedoch ratsam, immer eine korrekt belichtete Aufnahme zu erstellen. Diese wird dann mit den benötigten Unter- und Überbelichtungen zu einem HDRI verrechnet. Dies erklärt auch, weshalb meist eine ungerade Zahl an Ausgangsaufnahmen in ein HDRI einfließt. |
2.6.2 Manuelle Belichtung 

Nachdem die Kamera einen sicheren Stand hat und richtig ausgerichtet ist, sollten Sie die Belichtungsparameter manuell einstellen. Bis auf den Autofokus sollte alles an der Kamera in Handarbeit eingestellt werden.
Weißabgleich | Mit dem Weißabgleich »eichen« Sie die Kamera auf die Farbtemperatur des Lichtes am Aufnahmeort. Für die HDR-Fotografie empfiehlt es sich, den automatischen Weißabgleich der Kamera abzuschalten, da sich im Rahmen einer Belichtungsserie die Werte ändern können. Den Weißabgleich können Sie zwar noch nachträglich anpassen – vor allem, wenn Sie im RAW-Format fotografieren –, die volle Kontrolle haben Sie jedoch nur bei der manuellen Einstellung des Weißabgleichs.
Um einen manuellen Weißabgleich durchzuführen, wird eine Graukarte oder eine sogenannte Weißabgleichkarte benötigt. Zur Not kann man sich auch mit einem weißen Blatt Papier oder dem grauen Asphalt behelfen. Die Karte fotografieren Sie formatfüllend unter den vorherrschenden Lichtbedingungen. Das dabei entstandene Bild geben Sie anschließend über das Kameramenü als Referenz für den Weißabgleich an. Alle nachfolgenden Bilder sollten sich dann auf genau diesen Weißabgleich beziehen.
| Chromatische Adaption |
|
Das menschliche Auge vollführt praktisch einen automatischen Weißabgleich. Durch die Ausstattung der Netzhaut ist es den Augen möglich, sich schnell an unterschiedliche Farbtemperaturen anzupassen. Somit sieht ein Blatt Papier immer gleich weiß aus, ob unter Kunst- oder unter Tageslicht betrachtet. Diesen physiologischen Vorgang nennt man chromatische Adaption (nicht zu verwechseln mit der chromatischen Aberration). |
| Farbtemperatur | Lichtquellen |
| 2000 K | Kerzenlicht |
| 2500 K | Glühbirne 40 W |
| 3000 K | Sonnenuntergang, Halogenlampe (Warmweiß) |
| 3200 K | Fotolampe Typ B |
| 3400 K | Fotolampe Typ B |
| 4000 K | Leuchtstoffröhre (kaltweiß) |
| 4500 K | Xenon-Lampe, Lichtbogen |
| 5000 K | Morgen-/Abendsonne |
| 5500 K | Blitzgerät |
| 6000 K | bedeckter Himmel |
| 7000 K | Schatten unter wolkigem Himmel |
| 8000 K | Schatten unter blauem Himmel |
| 12000 K | blauer Himmel |
Tabelle 2.1 Die Tabelle zeigt einige Werte für typische Lichtquellen in der Fotografie. Die Werte sind als Richtwerte anzusehen und können leicht variieren.
Viele Digitalkameras haben neben dem automatischen Weißabgleich noch verschiedene vorgegebene Einstellmöglichkeiten, zwischen denen gewählt werden kann. Das erspart den manuellen Weißabgleich und liefert mit ein bisschen Übung ebenso gute Ergebnisse. Sofern das Ergebnis nicht hundertprozentig den Erwartungen entspricht, können Sie den Weißabgleich im Rahmen der Vorbereitung zur HDR-Erstellung im Bildbearbeitungsprogramm nachjustieren.
| Farbtemperatur |
|
Die Farbtemperatur gibt Auskunft über die spektrale Energieverteilung einer Lichtquelle und zeigt deren Intensität auf. Die Temperatur einer Farbe wird in Kelvin (K) angegeben. In der Fotografie beschreibt die Farbtemperatur die Farbunterschiede diverser Lichtquellen von Rot bis Blau. Die für Fotografen relevante Kelvin-Skala reicht von Rot, das bei etwa 1500 K liegt, bis hin zu Blau, das eine Farbtemperatur von etwa 12000 K aufweist. Unsere Augen gleichen die unterschiedlichen Farben des Lichtes automatisch aus, so dass uns alle Farben neutral weiß erscheinen. Beispielsweise wirkt das Licht einer Glühbirne im Keller nach kurzer Zeit weiß. Dabei bewegt sich das Licht einer Glühbirne bei etwa 2500 K, was einem Dunkelorange-Farbton entspricht. Der neutrale Weißbereich liegt jedoch bei etwa 5400 K. Die Kamera kann sich nicht automatisch anpassen und muss daher einen Weißabgleich durchführen. Ansonsten hätte das Kellermotiv im Licht der Glühbirne einen starken Rotstich. |
| Weißabgleich und RAW |
|
Wenn die Bilddaten im RAW-Format vorliegen, kann der Weißabgleich ohne jegliche Verluste nachträglich durchgeführt werden. Das bietet natürlich den größten Spielraum, weil die vorhandenen RAW-Aufnahmen je nach Geschmack immer wieder neu eingestellt und anschließend als TIFF oder JPEG abgespeichert werden können. |
Abbildung 2.41 Dieses Bild wurde mit einer Farbtemperatur-Einstellung von 2500 Kelvin aufgenommen und zeigt einen deutlichen Farbstich.
Abbildung 2.42 Dasselbe Bild mit einer Farbtemperatur von 8500 Kelvin. Der blaue Farbstich ist verschwunden, aber die Farben wirken leicht gelblich.
Abbildung 2.43 Diese Aufnahme mit einer Farbtemperatur von 5500 Kelvin wirkt am natürlichsten.
| Symbol | Modus | Farbtemperatur |
| Automatisch | 3000–7000 K | |
| Tageslicht | 5200 K | |
| Schatten | 7000 K | |
| Wolkig | 6000 K | |
| Kunstlicht | 3200 K | |
| Leuchtstoff | 4000 K | |
| Blitz | 6000 K | |
| Manuell | 2000–10000 K |
Tabelle 2.2 Die Tabelle zeigt die Möglichkeiten der Voreinstellungen für den Weißabgleich (an einer Canon-Kamera). Je nach Lichtsituation lässt sich über das Kameramenü der passende Modus auswählen.
Manueller Belichtungsmodus und Blendenwahl | Nun wird es Zeit, die Kamera auf den manuellen Belichtungsmodus umzuschalten. Dieser ist am Gehäuse zu wählen und meist mit einem M als Symbol gekennzeichnet. Entsprechend dem Motiv und Ihren eigenen Vorstellungen zur Bildgestaltung wählen Sie nun die passende Blende: Je größer die Blendenzahl, desto kleiner die Blendenöffnung. Je kleiner die Blende, desto höher die Schärfentiefe. Je kleiner die Blendenöffnung, desto länger muss der Sensor belichtet werden.
Abbildung 2.44 Am Wahlrad der Kamera können die automatischen und halbautomatischen Programme eingestellt werden. Um die Ausgangsaufnahmen für ein HDR-Bild zu erstellen, wird der manuelle Modus M gewählt.
Die Belichtungszeit können Sie in diesem Fall außer Acht lassen, da die Kamera einen relativ unbeweglichen Stand auf dem Stativ hat und ein Verwackeln ausgeschlossen werden kann.
| Kreativprogramme |
|
Canon nennt seine halbautomatischen Aufnahmemodule Kreativprogramme. Möglicherweise bezeichnen unterschiedliche Hersteller die Programme anders, inhaltlich sind sie jedoch nahezu identisch. Inwieweit die Kreativprogramme in der HDR-Fotografie einsetzbar sind, ist den folgenden Kurzbeschreibungen zu entnehmen. Manuelle Einstellung Zeitautomatik Blendenautomatik Programmautomatik Schärfentiefenautomatik (A-DEP bei Canon-Kameras) Neben den halbautomatischen Programmen bieten die Kameras auch vollautomatische Programme an. Diese können allesamt für die HDR-Fotografie nicht eingesetzt werden. HDR-Imaging bedeutet zuallererst einmal Fotografie in Handarbeit. |
| TIPP |
|
Um unnötiges Farbrauschen zu vermeiden, sollten Sie die Lichtempfindlichkeit (ISO) gering halten. Ein Wert bis maximal 200 ist ideal. Da die Kamera auf einem Stativ steht, ist die längere Belichtungszeit nicht sonderlich tragisch. |
Die richtigen Belichtungszeiten bestimmen | Im nächsten Schritt wird die korrekte Belichtungszeit bestimmt. Bei vielen Kamera-Typen kann dies im manuellen Modus durchgeführt werden. Wenn dies nicht möglich ist, ermitteln Sie die richtige Belichtungszeit im Automatikmodus, und behalten Sie sie im Kopf oder schreiben Sie sie auf.
Sollen insgesamt drei Aufnahmen gemacht werden, empfiehlt sich ein Abstand von je zwei Blenden (siehe auch Tabelle 1.2, »Lichtwerte bei ISO 100«, in Kapitel 1) um insgesamt ausreichend viele Helligkeitswerte zu erhalten: –2 EV, 0 EV, +2 EV.
Ähnliches gilt, wenn insgesamt fünf oder sieben Aufnahmen gemacht werden sollen. Bei sieben Aufnahmen kann der Abstand aber auch schon auf eine Belichtungsstufe (EV) reduziert werden. Wie viele Aufnahmen letztendlich gemacht werden, hängt vom Kontrastumfang des Motivs und vom Belichtungsabstand ab. Bei einer sehr kontrastreichen Szenerie sollten Sie einen geringen Belichtungsabstand verbunden mit einer relativ hohen Anzahl an Aufnahmen wählen. Wenn beispielsweise das Innere einer Glühbirne abgebildet werden soll, bedarf es zusätzlicher Aufnahmen mit extrem kurzer Belichtungszeit.
| TIPP |
|
Ein kleines Notizbuch wirkt manchmal Wunder. Vor allem, wenn Sie im Studio oder zu Hause versuchen, die Aufnahmesituation zu rekonstruieren. Warum wurde das Motiv mit diesen Einstellungen ausgerechnet aus dieser Position fotografiert? Kurze Notizen zur Location, zu den Verhältnissen und zu den eigenen Gedanken über das Ziel der Aufnahmen geben Aufschluss und liefern letztendlich einen wesentlichen Beitrag zur eigenen Erfahrung. |
| TIPP |
|
Die Verwendung eines Fernauslösers beziehungsweise eines Kabelauslösers ist dringend zu empfehlen, um zusätzliche Verwackler durch die manuelle Auslösung zu vermeiden. Profis verwenden bei einer Spiegelreflexkamera auch die sogenannte Spiegelvorauslösung, die über das Kameramenü aktiviert werden kann. |
Im Folgenden finden Sie eine typische Belichtungsreihe für ein HDR-Bild: Es wurden insgesamt neun Aufnahmen im manuellen Modus erstellt und für eine durchgängige Schärfentiefe die Blende 8 verwendet. Die Lichtempfindlichkeit von ISO 100 garantierte rauschfreie Aufnahmen. Da die Bilder unter gewöhnlichem Glühbirnenlicht aufgenommen wurden, wurde für den Weißabgleich die Kameravoreinstellung für Kunstlicht (3200 K) gewählt. Um den größtmöglichen Spielraum bei der Bildverarbeitung zu haben, wurde für die Aufnahmen das RAW-Format ausgewählt. Diese Werte wurden während der gesamten Aufnahmeserie nicht mehr verändert.
Während einer Aufnahmeserie verändern Sie also ausschließlich die Belichtungszeit. In diesem Fall war es eine Blendenstufe. Das entspricht einer Halbierung der Belichtungszeit, beginnend mit der am längsten belichteten Aufnahme.
Abbildung 2.45 Abbildung 2.45
Abbildung 2.46 Abbildung 2.46
Abbildung 2.47 Abbildung 2.47
Abbildung 2.48 Abbildung 2.48
Abbildung 2.49 Abbildung 2.49
Abbildung 2.50 Abbildung 2.50
Abbildung 2.51 Abbildung 2.51
Abbildung 2.52 Abbildung 2.52
Abbildung 2.53 Abbildung 2.53
Abbildung 2.54 Durch die Erzeugung des HDR-Bildes aus neun Ausgangsaufnahmen weist das Tonemapped-HDRI eine Zeichnung bis in die Tiefen des Schrankes auf. Andererseits ist auch die Zeichnung der hellen Augen des Stoff-Elefanten ausgeprägt.
| TIPP |
|
Schauen Sie sich das Histogramm der Bilder direkt nach der Aufnahme an. Anhand des Tonwertverlaufs können Sie beurteilen, ob die Bilder für ein HDRI geeignet sind und den notwendigen Kontrastumfang ausreichend abbilden. Mehr Informationen zum Histogramm, was es aussagt, und wie es zu lesen ist, finden Sie in Kapitel 1. |
2.6.3 Automatische Belichtungsreihe 

Die meisten Spiegelreflexkameras haben eine Belichtungsreihenfunktion. In Verbindung mit der Einstellung für Reihenaufnahmen können hiermit in der Regel drei Aufnahmen in Serie mit unterschiedlichen Belichtungen erstellt werden. In vielen Fällen reicht es aus, für ein HDR-Bild nur drei Ausgangsbilder zu erstellen.
Beispielsweise können mit der Nikon D2X sogar bis zu neun Aufnahmen mit maximal 1 EV Unterschied erstellt werden. Es ist anzunehmen, dass die Kamerahersteller der Nachfrage nach einer erweiterten Belichtungsreihenfunktion für die HDR-Fotografie nachkommen werden.
Abbildung 2.55 Einstellungen für eine automatische Belichtungsreihe an einer Spiegelreflexkamera von Canon
2.6.4 Manuelle Belichtungsreihe mit einer Kompaktkamera 

Weniger komfortabel ist die Erstellung einer Belichtungsreihe mit einer Kompaktkamera. Je nach Ausstattung lässt sich die Kamera, ähnlich wie die Spiegelreflexkamera, manuell einstellen und verfügt häufig über eine Belichtungsreihenfunktion. Zumindest sollte die Kamera über eine manuelle Belichtungskorrektur verfügen. Wer sich jedoch intensiv mit der HDR-Fotografie auseinandersetzen will, wird mittelfristig die umfangreichen Möglichkeiten einer semiprofessionellen Spiegelreflexkamera zu schätzen wissen.
2.6.5 Belichtungsreihe aus der Hand 

Mit Hilfe der Funktionen »Ausrichten« und »Geisterbilder unterdrücken« werden kleinere Unregelmäßigkeiten, die durch ein Verwackeln beim Fotografieren entstehen, ausgeglichen. Viele der HDR-Programme verfügen über diese Funktionen und richten die Ausgangsaufnahmen entsprechend deckungsgleich aus oder rechnen die sogenannten Geisterbilderscheinungen aus dem Bild heraus. Das hat meist eine Qualitätseinbuße zur Folge, die sich in einem erhöhten Rauschen beispielsweise im abgebildeten Himmel bemerkbar macht.
Abbildung 2.56 Die Einstellungen für eine Aufnahme aus der Hand: Eine hohe ISO-Zahl und eine relativ offene Blende sorgen für kurze Verschlusszeiten.
Nichtsdestotrotz können Belichtungsreihen auch aus der Hand erstellt werden. Dabei sind folgende Hinweise zu beachten:
- Je dunkler die Aufnahmeszene ist, desto länger wird die Belichtungszeit sein. Dadurch steigt natürlich die Gefahr des Verwackelns.
- Um kürzere Belichtungszeiten zu erreichen, sollte eine relativ große Blende gewählt werden.
- Eine höhere ISO-Einstellung verkürzt ebenfalls die Belichtungszeit.
- Grundsätzlich ist eine Belichtungsreihe aus der Hand nur mit der Belichtungsreihenfunktion sinnvoll.
- Der Kontrastumfang der Aufnahmeszene sollte auch mit wenigen Bildern (in der Regel drei Aufnahmen) für die HDR-Generierung geeignet sein.
Abbildung 2.57 Die drei Aufnahmen für dieses HDR-Bild wurden aus der freien Hand erstellt. Die ISO-Einstellung von 400 führte zu einem akzeptablen Ergebnis. Bei näherem Hinschauen fallen jedoch leichte Unregelmäßigkeiten und Farbsäume auf, die vom Einsatz der Funktion »Geisterbilder unterdrücken« herrühren.
Ihre Meinung
Wie hat Ihnen das Openbook gefallen? Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback als E-Mail an kommunikation@rheinwerk-verlag.de.


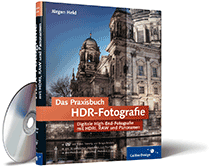
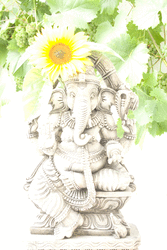
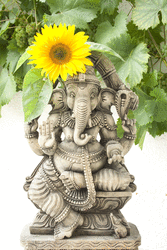

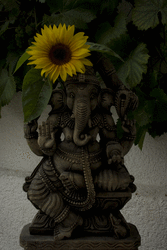

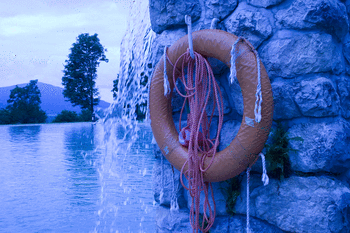










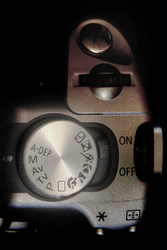
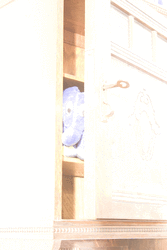





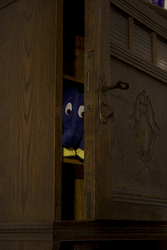
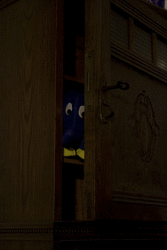
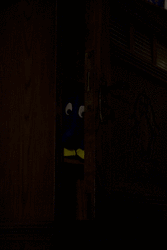


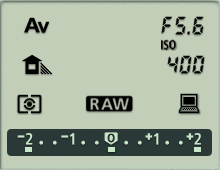

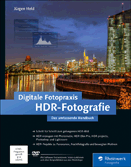
 bestellen
bestellen


