4 Auswahl der möglichen virtuellen Maschine
Es gibt sehr viele verschiedene Serversysteme innerhalb eines Unternehmens, aber welche eignen sich für einer Virtualisierung und welche bringen virtualisiert nur Nachteile?
Ich habe lange überlegt, welches Thema in diesem Buch zuerst behandelt werden sollte, und stieß dabei auf ein typisches Henne-Ei-Problem: Plane ich erst das Wirt-System und überlege mir dann, welche virtuellen Maschinen darauf sinnvoll laufen können, oder plane ich erst alle virtuellen Maschinen und errechne erst danach den Leistungsbedarf des Wirt-Systems. Hinzu kommt dann noch die Auswahl der Virtualisierungssoftware, mit der es sich ganz ähnlich verhält.
Hier das Ergebnis meiner Gedankenspiele:
- Zuerst sollte man die virtuellen Maschinen planen, um die entsprechenden Anforderungen an die Virtualisierungssoftware und das Wirt-System präzise formulieren zu können.
- Danach sollte eine Virtualisierungssoftware ausgesucht werden, die alle Anforderungen der virtuellen Maschinen erfüllt.
- Anschließend kann man seine Aufmerksamkeit dem Wirt-System und der Infrastruktur widmen.
Mir ist bewusst, dass diese Vorgehensweise aufgrund bestehender IT-Strukturen nicht immer möglich ist; sinnvoll bleibt sie dennoch.
Die Auswahl des richtigen physikalischen Servers zur Virtualisierung kann unter Umständen sehr problematisch sein. Ein typischer Kandidat kann ein Server sein, auf dem nur nachts Jobs mit hoher Systemleistung ablaufen, damit es zu keiner Zeitverzögerung kommt (die wiederum andere Dienste behindern könnten). Andere Server wiederum dümpeln den ganzen Tag bei einer Prozessorauslastung von 1 bis 5 % vor sich hin, arbeiten aber ununterbrochen auf den Festplatten. Man muss viele Aspekte berücksichtigen, um herauszufinden, ob ein Server sich für eine Virtualisierung eignet.
Zu den am schwierigsten zu bewertenden Kandidaten gehören zweifelsfrei jene Server, die in naher Zukunft angeschafft werden sollen, über deren Auslastung man aber keinerlei fundierte Aussagen treffen kann. Dort kann man nur auf Erfahrungen der Entwickler der eingesetzten Software oder auf Berichte in Zeitschriften und im Internet bauen. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor bleibt leider trotzdem bestehen.
4.1 Welche Server existieren im Unternehmen? 

Dies sollte an erster Stelle stehen: eine Ist-Aufnahme der physikalischen Maschinen und, falls schon entsprechende Planungen existieren, welche zukünftigen Server gebraucht werden. Vor dem weiteren Handeln sollten detailliert Informationen über diese Server gesammelt werden. Diese Datensammlung kann manuell oder unter Zuhilfenahme von Produkten geschehen, die Ihnen gerade diese Aufgaben vereinfachen können (z. B. Platespin PowerRecon). Je sorgfältiger Sie vorgehen, desto leichter fällt Ihnen die Auswahl und spätere Migration der physikalischen Server. Hier ist eine genaue Auswertung zwingend notwendig, da Fehler sich auf den späteren Erfolg einer Servervirtualisierung negativ auswirken können.
Welche Aspekte sind gehören zu den entscheidenden?
- Prozessortyp
- Taktfrequenz
- Anzahl der Prozessoren
- besondere Merkmale wie Hyperthreading
- durchschnittliche Auslastung
- Auslastungsspitzen
- Tageszeiten hoher Auslastung
- Hauptspeicher
- Geschwindigkeit
- Größe des Hauptspeichers
- durchschnittliche Hauptspeicherauslastung
- Auslastungsspitzen
- Zeitpunkte hoher Auslastungen
- Massenspeicher
- Anbindung (IDE, SCSI, FibreChannel)
- Anzahl der Festplatten und der Kontroller
- Konfiguration der RAID Sets und Level
- Geschwindigkeit der Festplatten und der Controller
- Partitionen (Anzahl, Bootpartitionen)
- Festplattenspeicherplatz pro Partition
- derzeitige Festplattenspeicherbelegung pro Partition
- Abhängigkeit der Programme von Laufwerksbuchstaben
- durchschnittliche Schreib-/Lesezugriffe pro Festplatte bzw. Controller
- Schreib-/Lesezugriffsspitzen pro Festplatte bzw. Controller
- Zeitpunkte hoher Schreib-/Lesezugriffe pro Festplatte bzw. Controller
- Netzwerk
- Topologie (Token Ring, Ethernet)
- Anzahl der Netzwerkadapter
- Geschwindigkeit der Netzwerkadapter
- Anbindung an unterschiedliche Netzwerke
- Netzwerkzugehörigkeit über VLAN
- Routingfunktionalität des Systems
- durchschnittliche Auslastung pro Netzwerkadapter
- Auslastungsspitzen pro Netzwerkadapter
- Zeitpunkte hoher Auslastung pro Netzwerkadapter
- besondere Zusatzadapter
- ISA-Karten (ISDN, Grafik)
- PCI-Karten (Systemüberwachung, ISDN)
- externe Anschlüsse
- verwendete serielle Anschlüsse (Dongle)
- verwendete parallele Anschlüsse
- verwendete USB-Adapter (Dongle)
- verwendete Firewire-Schnittstellen
- verwendete externe SCSI-Geräte
- Betriebssystem
- welches Betriebssystem (Version, Patchstand)
- besondere Treiber innerhalb des Betriebssystems
- Software
- benötigte installierte Software
- Eigenentwicklungen
- Software, die auf externe Geräte zugreift (Dongle, Temperaturüberwachung etc.)
- Servereigenschaften
- Wichtigkeit des Systems
- benötigte Systemsicherheit (auch Ausfallsicherheit)
- maximal akzeptable Ausfallzeit des Systems
- derzeitige Backuplösung
- derzeitige Disaster Recovery-Lösung
- derzeitige Fernsteuerung
- Mitglied eines Clusters
Diese Auflistung können Sie Ihren Wünschen gemäß anpassen oder erweitern, da es in der IT immer wieder Exoten gibt, die nicht zum Standard gehören.
Trotzdem sollte Ihnen diese Liste eine Hilfe bei der ersten Bestandsaufnahme der physikalischen Serversysteme sein. Gerade Themen wie Systemsicherheit und Ausfallsicherheit sind von enormer Bedeutung u. a. bei der späteren Auswahl der Virtualisierungssoftware und des Wirt-Systems. Wie Sie die verschiedenen Auslastungsmessungen an den Servern durchführen, werden Sie im Laufe des Kapitels erfahren.
Ihre Meinung
Wie hat Ihnen das Openbook gefallen? Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback als E-Mail an kommunikation@rheinwerk-verlag.de.


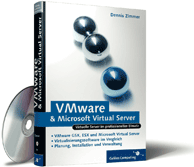


 Ihre Meinung
Ihre Meinung



